Wir haben dieses Jahr wieder das Around the World in 14 Films Festival besucht, das dieses Jahr zum 19. Mal stattfand. Das Programm des Festivals setzt sich erneut zusammen aus den Lieblingen der diesjährigen Festival-Saison, es laufen Filme aus Locarno, Venedig, Cannes und allen anderen Ecken der Welt. Das verbindende Element in diesem Jahr scheint Harte Zeiten gewesen zu sein: Die Filme, die wir gesehen haben, berichten vom Leid und dem Leben unter schweren Bedingungen und das Zurechtfinden in diesen Lebensrealitäten. Von somalischen Dörfern, italienischen Bergen und jordanischen Teenagern, hier ist alles, was wir dort gesehen haben:
The Village next to Paradise
Mo Harawes Spielfilmdebüt und Eröffnungsfilm des diesjährigen Afrikamera-Festivals in Berlin, The Village next to Paradise, ist der erste somalische Film auf einem der großen A-Festivals, er lief in der Sektion “Un Certain Regard” in Cannes. Der Film verfolgt drei Figuren einer Familieneinheit in einem kleinen Dorf, den Jungen Cigaal (Ahmed Ali Farah), seinen Vater Mamargade (Ahmed Mohamoud Salleban) und dessen frisch geschiedene Schwester Araweelo (Anab Ahmed Ibrahim). Durch diese drei Figuren soll eine Kritik an den Umständen der somalischen Gesellschaft formuliert werden: Cigaals Schule muss schließen, weil es keine ausgebildeten Lehrkräfte gibt, Marmagade wechselt von einem Job zum nächsten, für sich selbst und seinen Sohn zu Sorgen wird täglich von neuem zu einer Herausforderung, und Araweelo muss als geschiedene Frau kämpfen, um ihren Traum von der eigenen Schneiderei zu verwirklichen. Über alledem hängt das verheißungsvolle Rauschen und Röhren amerikanischer Kampfdrohnen, die, wie uns die Eröffnungsszene berichtet, in der Lage sind, zu jedem Moment präzise Schläge auf Einzelpersonen durchzuführen. Der Papa bekommt dann von seinem Sohn im Grundschulalter beigebracht, was im Ernstfall zu tun ist: Auf den Bauch legen und mit den Händen den Kopf schützen. Harawe erzählt in sehr geduldigem Tempo von diesen Figuren und ihren Umständen, die den Alltag am Existenzminimum darstellen. Dabei verliert sich der Film jedoch nicht in persönlichen Leidensgeschichten, sondern weist bewusst auf soziale Probleme. Besonders bezeichnend ist die Szene, in der Araweelo einen Kredit für ihre Schneiderei verweigert wird, weil sie als alleinstehende Frau nicht befugt ist, nur Paare könnten einen Kredit erhalten. Der Film zeigt auf sehr eindringliche Weise, wie unweigerlich das Persönliche und das Politische verknüpft sind.

Es ist ersichtlich, weshalb Cannes The Village Next to Paradise zeigen wollen würde: Der Film weist auf gesellschaftliche Missstände in Somalia hin, wurde mit französischen Geldern finanziert und bietet dem europäischen Publikum einen einfachen Zugangspunkt in eine “fremde” Welt. Der Stil des Films entspricht dabei dem klassischen transnationalen Festivalfilm: Ruhiges Erzähltempo, nah an den Figuren, sozialkritisch, aber letzten Endes doch versöhnlich und für ein europäisches Publikum gut verdaulich. Es wird niemandem auf die Füße getreten, und niemand wird diesen Film mit Fragen verlassen. Das erste A-Festival zu sein, das einen somalischen Film zeigt, wertet Cannes’ Image als globale Veranstaltung vielfach auf, genauso wie es das Around the World in 14 Films ebenfalls tut. Gleichzeitig fühlt sich The Village Next to Paradise nach Filmfestival-Massenware an und ist handwerklich sowie inszenatorisch schlichtweg nicht interessant genug, um tatsächlich für Aufsehen zu sorgen. Vielmehr sollte in Frage gestellt werden, warum der erste somalische Film in Cannes einer ist, der durch die Biographie des Regisseurs (der seit 2009 in Europa lebt) und die größtenteils europäische Finanzierung sich trotz seines Fokus auf Somalia und das Leben dort so europäisch anfühlt. Letzten Endes sollen die Sehgewohnheiten des Publikums bei den großen Festivals auch nicht großartig herausgefordert werden, man bekommt das zu sehen, was man immer sieht, nur eben dieses Mal in Somalia. An dieser Stelle möchte ich den Wunsch nach mehr Mut äußern: Mehr Mut bei der Inszenierung, den Festival-Status-Quo zu ignorieren, und eine eigene filmische Handschrift zu entwickeln, aber auch mehr Mut bei der Programmierung von afrikanischen Eigenproduktionen, die nicht für den Festivalzyklus gemacht sind und europäische Sehgewohnheiten brechen.
The Village Next to Paradise hat erzählerischen Anspruch und ist ambitioniert in seinem Umfang sowie liebevoll in seiner Figurengestaltung, doch bleibt die Inszenierung dieser Erzählung und Figuren gewöhnlich und nicht sehr originell. Der Film beugt sich zu sehr dem transnationalen Festivalzyklus, der größtenteils westliches Publikum bespielt und verliert dabei die Bildung einer eigenen Filmhandschrift aus den Augen. Beim Around the World in 14 Films Festival gewann The Village next to Paradise am 07.12. den Regiepreis, die Jury bestehend aus Maryam Zaree, Annika Pinske und Fabian Stumm spricht von einem „selbstbewussten und kühnen“ Debüt. Wir gratulieren herzlich dem Regisseur Mo Harawe und seinem Team. (mb)
Caught by the Tides
Ich hatte vor Caught by the Tides noch keinen anderen Film des chinesischen Auteurs Jia Zhangke gesehen. Das mag einigen als Nachteil erscheinen, besteht doch weitaus mehr als die Hälfte des Films aus alten Aufnahmen anderer Jia-Filme, die zum Teil 22 Jahre alt sind. Das fällt auch dem Laien auf, denn die Bilder sind auf Film oder Video gedreht, die Mode ist nicht zeitgemäß und die Darsteller sehen jünger aus als auf aktuellen Fotos. Diese neue Verwertung ungenutzter Aufnahmen (böse Zungen würden von “Recycling” sprechen) mag einigen als arbeitsfaule Sparmaßnahme erscheinen, denn es handelt sich schließlich nicht um ein Langzeitprojekt, für dass diese Szenen gedreht wurden, sondern um eine vollständige Rekontextualisierung dieser Szenen und Umdeutung ihrer Inhalte, um in dieses neue Projekt integriert werden zu können. Dabei vermengt Jia dokumentarische und inszenierte Aufnahmen, doch sind sie sich in diesem Film in ihrem Wahrheitsgehalt ebenbürtig. Die Handlung in Caught by the Tides steht zwar nicht im Vordergrund, bietet aber dafür umso mehr Gelegenheiten für filmische Pirouetten, Umwege und Einschübe. Um die Handlung grob zu umreißen: Guo Bin (Zhubin Li) verlässt seine Partnerin Qiao Qiao (Zhao Tao), um in einer anderen Provinz Geld zu verdienen. Nach einigen Jahren der Stille begibt sie sich auf die Suche nach ihm. Doch in diesem Film von konkreten Figuren zu sprechen, ist eigentlich nicht zielführend. Zhao Tao, die auch mit Jia Zhangke verheiratet ist, stand schon oft vor der Kamera, und auch Zhubin Li taucht in weiteren seiner Filme auf. Die Verwendung von älteren Aufnahmen, in denen sie gänzlich andere Figuren mit anderen Geschichten und anderen Namen spielen, die jedoch auf “Qiao qiao” und “Guo Bin” transponiert werden, löst diese Figuren als konkrete Charaktere auf. Viel mehr ist es ein Film über Zhao Tao und Zhubin Li selbst, ihre Tätigkeit als Darsteller*innen und ihre alternden Gesichter. In dieser Hinsicht ist die Integration von dokumentarischen Aufnahmen kein Stilbruch, denn auch die inszenierten Bilder dokumentieren hier mehr als sie erzählen: Sie dokumentieren vor allem die Darstellenden und ihre Körper. Wir sehen diese Figuren in unterschiedlichen Lebenssituationen und -abschnitten über viele Jahre aus verschiedenen Filmen zusammengeschnitten, als junge Menschen, als alte Menschen, beim arbeiten und tanzen. Caught by the Tides erinnert die Alten daran, dass sie jung waren, und die Jungen daran, dass sie altern werden.
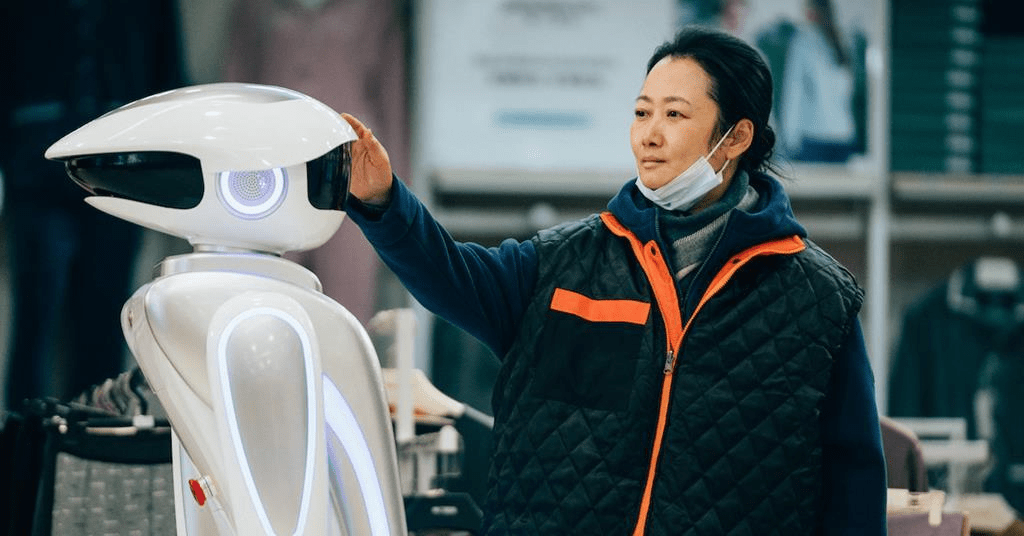
Die Musik spielt eine fast zentralere Rolle in Caught by the Tides, als die Handlung. Jia Zhangke schneidet viele unterschiedliche Szenen zusammen, in denen Menschen gemeinsam singen, tanzen und musizieren. Diese Szenen stellen nicht nur spezifische Verortungen in Milieus und Zeitperioden dar, sondern charakterisieren maßgeblich die Atmosphäre des Films. Die Figuren bewegen sich größtenteils stumm durch ihre Umgebungen, von Zeit zu Zeit erscheinen Texttafeln, die Zhao Taos Gedanken widerspiegeln, doch abseits dessen spricht die Musik mehr als die Figuren. Die verschiedenen musikalischen Einlagen bekommen viel Platz im Schnitt und tragen stark zum mosaikartigen Charakter des Filmes bei. Viel mehr als einer klaren chronologischen oder narrativen Linie zu folgen ist Jia daran interessiert, Bilder, Töne und Lieder aufeinander abzustimmen und in einen Dialog treten zu lassen. Beinahe impressionistisch montiert werden unterschiedliche Bild- und Medienformate deren Zusammenhang nicht zwingend offensichtlich ist, doch tragen sie alle zum großen Bild der Menschen und Chinas in diesem Film bei. Die kapitalistische und digitale Expansion wird von Jia über die Jahre hinweg eindrücklich aufgezeichnet und findet im letzten Abschnitt des Films den Sprung in die Gegenwart. Hier sehen wir auch zum ersten Mal neue, spezifisch für diesen Film gedrehte Szenen, die während der Pandemie spielen. Das Ende des Films zeigt zwei Menschen, die vom Leben abgehängt wurden, in einer Welt in der sie sich nicht zurechtfinden. Soziale Medien und KI infiltrieren den Alltag zunehmend und vermitteln eine immense Trostlosigkeit. Der Bilderstrudel legt sich, die Realität setzt ein, der Film verlangsamt sich und kommt in den letzten Minuten mit einem Seufzer zum Erliegen.
Was zum Schluss bleibt, ist ein Film, der sich vor allem als ein Tribut versteht. Ein Tribut an Zhao Tao, Zhubin Li und an ein analoges Weltgefühl. Caught by the Tides steckt voller Nostalgie und Liebe gegenüber Vergangenem und somit legitimiert sich der Ansatz, den Film nur aus bestehendem Material zusammenzustellen, denn schließlich kann das Neue niemals das Gefühl des Alten replizieren. (mb)
Bird
In Bird lässt Andrea Arnold Dinge aufeinander knallen: das Reale mit dem Fantastischen, Analoges und Digitales und Menschen, oft gewaltsam, aber manchmal auch zärtlich. Arnold zeigt uns eine teilweise sehr düstere Welt, die dreckig und voller Gewalt ist. Die wackelige 16mm Handkamera ist immer ganz nah dran an Bailey, der 12-jährigen Hauptfigur (wirklich gut gespielt von Nykiya Adams). Mit ihr bewegen wir uns durch diese chaotische und oft beklemmende Welt. Bei ihrem jungen Vater (Barry Keoghan) hält sie es nicht aus und ihre Mutter lebt woanders in einer gewalttätigen Beziehung. Es scheint keine Zukunft zu geben in Bird, und keine Zuneigung. Irgendwann taucht dann Franz Rogowski auf, aber eigentlich müsste man sagen, dass er in diesen Film hereingeflattert kommt. Er spielt eine Art Fabelwesen, man weiß nicht, wo er herkommt und wer er ist, aber er hat eine ganz tolle, mystische Präsenz. Zwischenzeitlich wirkt der Film etwas ziellos. Man fragt sich, wohin das gehen soll und irgendwann wird die Atmosphäre auch echt hart. Gibt es denn wirklich nur Gewalt und Ablehnung hier? Zeitweise sieht es wirklich so aus, als ob Andrea Arnold uns selbst keinen Ausweg zeigen will, aber im Endeffekt ist der Film eine große Suche nach der Zuneigung und es ist dann wirklich schön, welches Ende sie findet. Stilistisch musste ich in Birds besten Momenten an Alice Rohrwachers Filme denken. Das liegt an dem krass analogen Look, mit den runden Ecken, der hier sogar noch rougher und ausgefranster ist, und diesen magisch realistischen Anleihen. Aber Arnolds Stil ist dreckiger, dunkler, härter und weniger poetisch. Und sie schafft es, sich irgendwie dem Kitsch hinzugeben, aber dabei etwas total Ehrliches offenzulegen. Bis unters Kinn tätowierte Männer singen Coldplay und Blur und irgendwie ist man am Ende davon berührt. (ym)

Vermiglio
Als nächstes der Blick nach Italien in die Alpen: Vermiglio überzeugt vor allem durch seine Inszenierung. Die schönen Bilder der schneebedeckten Landschaft und das unaufgeregte Erzähltempo erzeugen eine ganz angenehme Atmosphäre, in der sich dann aber doch eine recht tragische Geschichte abspielt. Der Film schildert das Leben einer Familie im titelgebenden Bergdorf zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Langsam kommen die Männer aus dem Krieg zurück und in einen von ihnen verliebt sich die junge Lucia. Schnell wird sie schwanger und sie heiraten. Doch der Mann kommt eigentlich aus Sizilien, wo er noch eine andere Familie hat. Irgendwann muss er zu ihr zurück und Lucia wartet vergebens auf ein Lebenszeichen. Irgendwie ist das, was der Film erzählt, entweder zu viel, oder zu wenig, um wirklich gut zu funktionieren. Seine tollen Bilder füllt er mit zu viel Handlung, um wirklich in ihnen versinken zu können, aber gleichzeitig ist es dann auch zu wenig, um eine befriedigende Geschichte zu erzählen. Im Zentrum steht Lucia, aber wir kriegen auch Einblicke in die Leben der anderen Familienmitglieder, jedoch verläuft sich davon vieles im Nichts. So ist am Ende etwas unklar, was genau der Film eigentlich erzählen wollte. Am ehesten ist es eine Geschichte über Mutterschaft. (ym)
Mond und Toxic
Weiter ging es bei mir mit zwei Filmen, die durchaus auf das Gemüt zu schlagen wussten. In Mond erzählt Kurdwin Ayub von einer MMA-Kämpferin am Ende ihrer Karriere, die sich ein neues Standbein suchen muss. Sie findet es als Personal-Trainerin und das führt sie nach Jordanien, wo sie drei Töchter einer reichen Familie trainieren soll. Ayub erzählt damit die Geschichte von einer Frau, die sich auf einmal mit einer ungekannten Machtlosigkeit konfrontiert sieht. Während sie zuvor als Kämpferin im Ring ihr Schicksal ganz in den eigenen Händen hielt, findet sie sich nun auf einmal in einem Umfeld, in dem ihr klare Grenzen gesetzt werden und an die sie immer wieder stößt. Mit der Zeit offenbart sich auch, unter welchen Verhältnissen die drei Schwestern leben, die sie trainieren soll. Der Film erzählt das alles in recht nüchternem Stil, lebt von der wirklich beeindruckenden Schauspielleistung von Hauptdarstellerin Florentina Holzinger und schreckt auch nicht vor drastischen Bildern zurück, die das Publikum zwischenzeitlich wahrnehmbar schockten. Auch wenn der Film in seiner Erzählung auf einige Stereotype zurückgreift, schafft er es, effektiv Spannung zu erzeugen. Am Ende stellt sich der Hauptfigur die Frage wie groß ihr Handlungsspielraum ist. Die Antworten, die sie findet, schmerzen.

Ebenfalls schmerzvoll ist die Erfahrung, die die Figuren in Toxic machen. Der Locarno-Gewinnerfilm der litauischen Regisseurin Saulė Bliuvaitė spielt in einer wirklich trostlosen Kleinstadt irgendwo in Litauen und zeigt uns eine Gruppe von 14-jährigen Mädchen, die unbedingt Models werden wollen, um der Perspektivlosigkeit ihrer Welt zu entkommen. Mädchen, die alles tun, um einem toxischen Schönheitsideal zu entsprechen. Toxic ist ein Film voller Bösartigkeit, Traurigkeit und auch Elend. Was der Film erzählen will ist klar: da ist diese hässliche Welt, in der die Mädchen leben, aber irgendwo ist da dieses Ideal, dem sie nacheifern, aber niemand von ihnen wird es erreichen und auf dem Weg dahin machen sie sich alle kaputt. Ich fand es schwer erträglich, mich diesem Elend über anderthalb Stunden hinzugeben. Mobbing, Essstörungen, Drogenkonsum und sexueller Missbrauch: hier ist wirklich alles dabei. Damit ist der Film zwar hart und ehrlich, aber er erschöpft sich eben auch schnell in der Kritik, die er übt. Außerdem hilft er nicht gerade dabei, das Bild, das von Osteuropa besteht, groß zu verändern. Es ist ja wirklich so, dass vor allem diese Elendsgeschichten aus Osteuropa auf Filmfestivals reüssieren, aber es muss doch auch noch andere Perspektiven und Geschichten geben, die man erzählen kann?
Vielleicht hilft hier dann nochmal der Blick auf Bird, wo sich Andrea Arnold ja auch nicht davor scheut, sozial prekäre und triste Lebenswelten zu zeigen. Aber sie gibt ihren Figuren mehr als nur dieses graue Leben. Bird geht über die reine Darstellung der Lebensverhältnisse hinaus, indem er unter anderem diese fantastische Ebene einzieht und das macht ihn für mich viel ertragreicher. (ym)
Das Around the World in 14 Films Festival findet jährlich Ende November/Anfang Dezember statt.
Hinterlasse einen Kommentar